Inhaltsübersicht
Wenn über Batterieleistung gesprochen wird, stehen oft Kapazität, Spannung oder Zyklenlebensdauer im Vordergrund – ein ebenso zentraler Kennwert wird leicht übersehen: der Innenwiderstand (Internal Resistance). Tatsächlich prägt er die dynamische Performance, den Wirkungsgrad und die langfristige Zuverlässigkeit maßgeblich. Dieser Beitrag erklärt die physikalische Natur des Innenwiderstands, seine entscheidende Rolle für Leistung und Lebensdauer sowie die Kernfaktoren seiner Veränderung – für ein umfassendes Verständnis dieses qualitätsbestimmenden Parameters.
1. Was ist der Batterieninnenwiderstand?
Der Innenwiderstand beschreibt den Widerstand, den die Batterie dem Stromfluss während des Betriebs entgegensetzt. Fließt beim Entladen Strom durch Elektroden, Elektrolyt und Leiter, entstehen verschiedene Widerstände – mit Spannungsabfall, Energieverlusten und Wärmeentwicklung als Folge.
Ohmscher Innenwiderstand: Entsteht durch die Leitfähigkeit von Leitern, Elektroden, Ableitern (Tabs), Elektrolyt und Separator – dominiert von den Materialeigenschaften.
Elektrochemischer Polarisationswiderstand: Rührt von endlichen Reaktionsgeschwindigkeiten an der Elektroden–Elektrolyt-Grenzfläche her; die Elektrodenpotenziale weichen unter Last vom Gleichgewicht ab (kinetikgetrieben).
Konzentrationspolarisationswiderstand: Entsteht durch Konzentrationsgradienten zwischen Elektrodenoberfläche und Elektrolytvolumen; unter hohen Strömen limitiert die Ionendiffusion.
In der Praxis wird häufig per Wechselstromverfahren ein äquivalenter Wert bestimmt (AC-Innenwiderstand), der alle Teilwiderstände zusammenfasst. Grundsätzlich gilt: ULast = UOCV − I × Rin. Je größer der Innenwiderstand, desto stärker der Spannungsabfall und desto geringer die nutzbare Ausgangsleistung.
2. Wie entsteht Innenwiderstand?
Die Ursachen sind vielfältig – geprägt von Materialeigenschaften, Fertigungsprozessen und Alterungsmechanismen:
Leitfähigkeit der Aktivmaterialien: Geringe Elektronenleitfähigkeit erhöht den Widerstandspfad.
Kontakt zwischen Kollektoren und Elektroden: Schlechter Kontakt steigert den Kontaktwiderstand.
Elektrolyt-Konzentration & Leitfähigkeit: Zu niedrige Konzentration oder gealterter Elektrolyt verlangsamt die Ionentransportgeschwindigkeit.
Separator-Impedanz: Geringe Porosität oder Verunreinigungen behindern Ionenfluss.
Schweiß- und Verbindungsqualität: Schlechte Schweißnähte, lose Schrauben, Oxidation verursachen lokal hohe Widerstände.
Mit der Nutzungsdauer steigen Innenwiderstand und Degradation durch Materialalterung, Aktivmaterial-Ablösung und das Dickenwachstum der SEI-Schicht. Der Innenwiderstandsanstieg ist einer der Haupttreiber der Leistungsabnahme.
3. Einfluss auf Leistung & Effizienz
Der Innenwiderstand bestimmt die Performance unter hoher Last direkt:
Spannungsabfall: Unter Last liegt die Klemmenspannung unter dem Nennwert; je höher der Strom, desto größer der Abfall.
Geringere Ausgangsleistung: P = U × I; sinkt U durch Rin, reduziert sich die verfügbare Leistung.
Niedrigerer Energiewirkungsgrad: Ein Teil der Energie wird in Wärme umgewandelt statt als Nutzleistung abgegeben.
Temperaturanstieg: I2R-Verluste heizen die Zellen auf; mangelhafte Kühlung beschleunigt Alterung bis hin zu Sicherheitsrisiken.
Praxisbeispiel: Zwei Batterien mit gleicher Kapazität – die mit geringerem Innenwiderstand hält bei Motorstart oder Wechselrichteranlauf die Spannung stabiler, liefert mehr Leistung und erwärmt sich weniger.
4. Innenwiderstand & Lebensdauer
Der Innenwiderstand dient als wesentliche Alterungskennzahl. Mit der Zyklenzahl steigt er aus mehreren Gründen:
SEI-Schicht-Evolution: Bei Lithium-Ionen-Batterien wächst die SEI an der Anode weiter, erhöht den Li-Ionen-Transferwiderstand – Hauptgrund des Rin-Anstiegs.
Elektrolyt-Zersetzung & Verlust: Nebenreaktionen verbrauchen aktives Lithium und verändern Zusammensetzung und Leitfähigkeit.
Strukturdegradation der Elektroden: Ablösung, Phasenumwandlungen, Auflösung und Kollektorkorrosion verlängern Elektronen-/Ionenwege.
Kontaktwiderstand an Grenzflächen: Mechanische Spannungen/Volumenänderungen erhöhen den Kontaktwiderstand zwischen Elektrode und Kollektor.
Steigt Rin, sinkt die nutzbare Leistung schon vor merklichem Kapazitätsverlust – die „praktisch nutzbare“ Kapazität schrumpft durch stärkere Spannungsabfälle. Langfristig führt hoher Rin zu Hotspots, thermischer Ermüdung oder Gehäuseverzug.
Definition des Lebensdauerendes: Industriestandards setzen häufig das Lebensdauerende bei 1,5- bis 2,0-fachem Anfangs-Rin an. Der Rin-Anstieg geht oft der Kapazitätsdegradation voraus und limitiert die Leistungsabgabe. Eine Zelle mit 80 % Kapazitätsrest kann bei verdoppeltem Rin im Gerät unter Last bereits ausfallen.
Fazit: Niedriger Innenwiderstand bedeutet nicht nur hohe Performance, sondern auch längere Zyklenlebensdauer.
5. Schlüsselfaktoren für den Innenwiderstand
Rin ist dynamisch und ändert sich mit Umwelt und Nutzung:
Temperatur: Bei Kälte steigt die Elektrolytviskosität, die Ionenmobilität sinkt – Rin nimmt stark zu. Hohe Temperaturen beschleunigen Nebenreaktionen und erhöhen Rin dauerhaft.
Ladezustand (SOC): Bei niedrigem SOC ist Rin deutlich höher.
Entladerate & Zyklenzahl: Hohe C-Raten verstärken mechanische Spannungen und Nebenreaktionen, Rin wächst schneller; mit Zyklen steigt Rin monoton.
Lagerdauer: Selbst im Stillstand laufen Nebenreaktionen ab; lange Lagerung erhöht SEI-Dicke und verändert Elektrolyt, Rin steigt.
Lithink LiFePO₄ nutzt Mehrpunkt-Temperatursensorik und aktives Balancing, um diese Variablen zu überwachen und Rin in verschiedensten Umgebungen stabil zu halten.
6. Wie misst man den Innenwiderstand?
Präzise Messung ist entscheidend für Performancebewertung, SOH-Monitoring und Pack-Matching. Gängige Verfahren:
Gleichstrom-Kurzzeitlast (DCIR): Kurzer Hochstrom-Impuls, Spannungsabfall messen und Rin berechnen; einfach, aber stark temperatur-/SOC-abhängig.
Wechselstrom-Innenwiderstand (ACIR): Milli-Ohm-Messung mit AC-Signal; genauer, benötigt Messgerät.
Elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS): Trennt Ohm-, Ladungsübertragungs- und Diffusionsanteile – Standard im Labor/Entwicklungsumfeld.
Für die Praxis empfiehlt sich die Messung bei Raumtemperatur und 50–70 % SOC, um reproduzierbare Referenzwerte zu erhalten.
7. Lithink: Low-IR-Designphilosophie
Lithink betrachtet „niedrigen Innenwiderstand“ als Kernziel der Leistungsauslegung. Unsere Lösungen:
A+ Automotive-Zellen: Zell-Rin ≤ 1 mΩ, exzellente Zyklenkonsistenz.
Doppelte Stromsammel-Struktur: Kupferlegierungs-Busbars minimieren Pfadimpedanzen.
Mehrpunkt-Temperaturüberwachung: Drei Sensoren erfassen Wärmeanstieg; das BMS begrenzt dynamisch den Strom.
Intelligentes BMS: Automatisches Balancing, Kurzschluss-/Überstromschutz und Niedrigtemperatur-Heizsteuerung sichern langfristige Stabilität.
Vollgekapselte, vibrationsfeste Struktur: 6-seitige Epoxid-Isolierung + Legierungsrahmen verhindern kontaktbedingte Rin-Erhöhungen durch Vibration.
So halten Lithink-Batterien selbst bei hohen Lasten – z. B. Wohnmobil-Klimaanlage, Inverterstart, Trolling-Motor – die Spannung stabil, entwickeln wenig Wärme und kombinieren hohe Leistungsabgabe mit langer Lebensdauer.
Fazit
Der Innenwiderstand begleitet den gesamten Lebenszyklus von Forschung, Produktion bis Anwendung. Er bestimmt die Momentanleistung und den Energiewirkungsgrad – und spiegelt den chemischen wie strukturellen Gesundheitszustand einer Batterie wider. Wer den Innenwiderstand versteht und kontrolliert, erhält mehr Leistung, längere Lebensdauer und höhere Sicherheit.







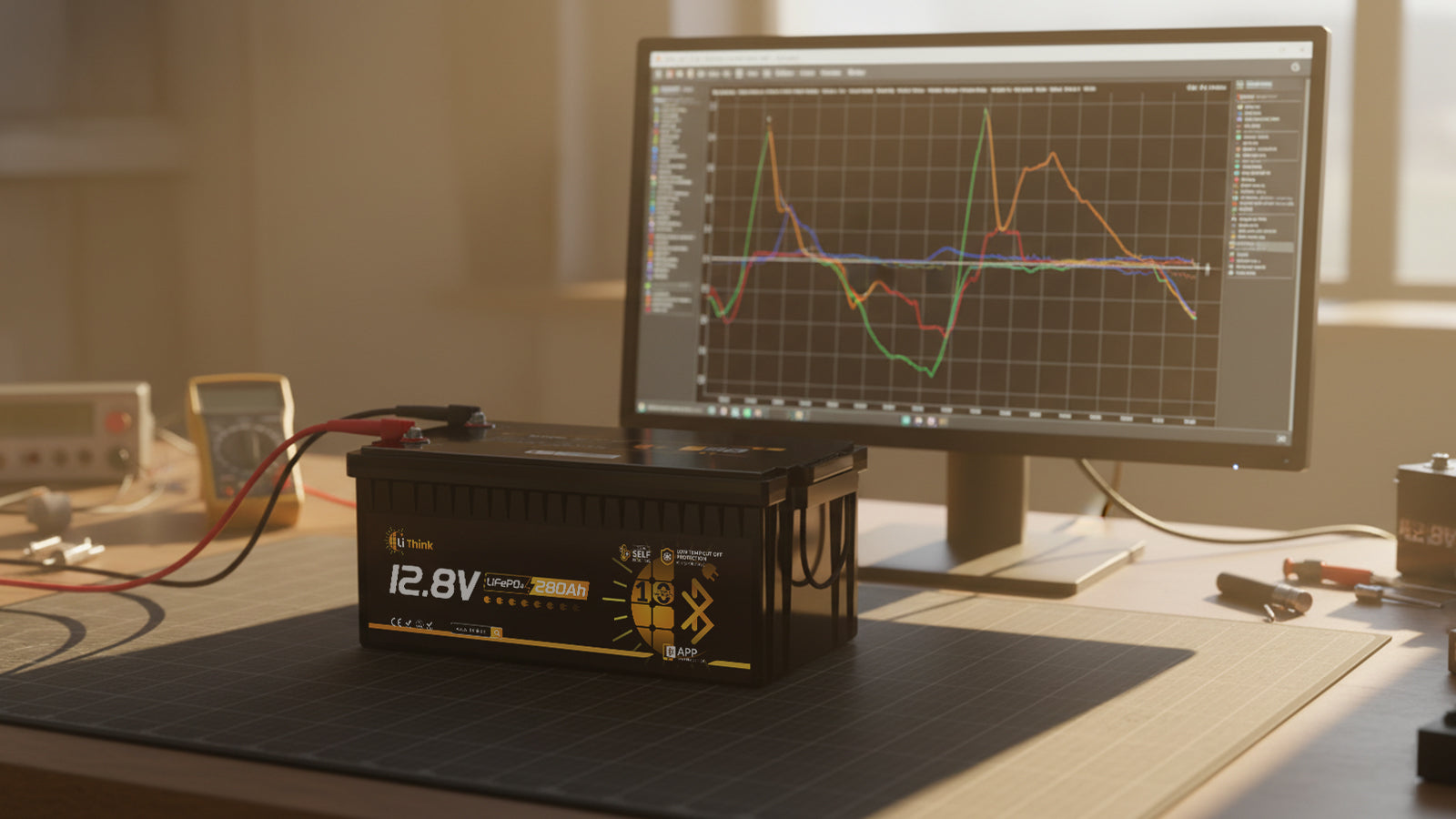
Share:
Lithiumbatterie bei Feuchtigkeit: Was passiert? Risiken & Leitfaden
LiFePO4-Selbstheizung: Sicher laden bei Kälte – Praxisleitfaden